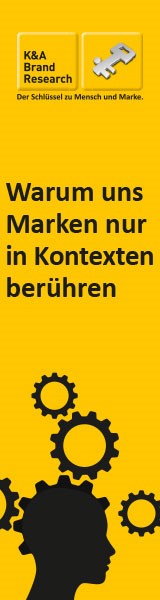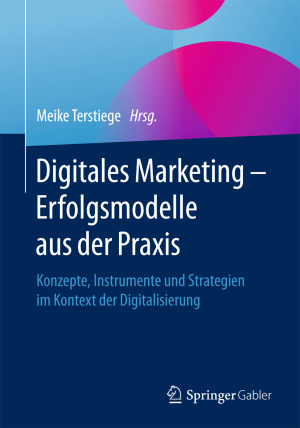Arbeitskosten - Arbeitskostenerhebung
Der Tariflohnindex 06 (Basis: Jahresdurchschnitt 2006 = 100) misst die Mindestlohnentwicklung in Österreich. Der TLI ist ein bedeutendes Bewertungskriterium für Lohn- und Gehaltsverhandlungen und stellt gemeinsam mit anderen Messzahlen zur Lohn- und Preisentwicklung einen wichtigen und sehr aktuellen Wirtschaftsindikator dar.
| Anbieter: | Statistik Austria |
|---|---|
| Veröffentlicht: | Mär 2012 |
| Autor: | Statistik Austria |
| Preis: | kostenlos |
| Studientyp: | Statistik |
|---|---|
| Branchen: | Arbeitswelt • Branchenübergreifend • Wirtschaft, Politik & Gesellschaft |
| Tags: | Arbeitskosten • Einkommen • Einkommensgerechtigkeit • Erwerbstätige • Familie • Gehälter • Haushalt • Jahreseinkommen • Lohnkosten • Löhne • Nettoeinkommen • Personalausgaben • Soziale Eingliederung • Soziales • Sozialstaat |
Arbeitskostenerhebung
2008 kostete die geleistete Arbeitsstunde (ohne Berücksichtigung der Lehrlinge und sonstigen Auszubildenden) in Österreich durchschnittlich 27,13 Euro. Sie war in der Produktion mit 29,89 Euro um 16% teurer als im Dienstleistungsbereich (25,72 Euro). Die Arbeitskosten je Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin (ohne Auszubildende) betrugen
Die Ergebnisse der Arbeitskostenerhebung 2008 repräsentieren insgesamt rund
Die Arbeitskostenstatistik gibt Auskunft über Höhe (stündlich, monatlich, jährlich) und Zusammensetzung (Bruttolöhne und -gehälter, Sozialbeiträge etc.) der Arbeitskosten, informiert aber auch über Anzahl und Struktur der Arbeitsplätze (Vollzeit, Teilzeit) und Arbeitsstunden (geleistete, bezahlte) in den verschiedenen Branchen, Beschäftigtengrößenklassen und Regionen der österreichischen Wirtschaft.
Die Betrachtung nach den Wirtschaftszweigen lässt eine breite Streuung der Arbeitskosten erkennen: Auf Ebene der ÖNACE-Abschnitte waren die Arbeitskosten je geleistete Arbeitsstunde (ohne Auszubildende) in der „Energieversorgung“ (44,59 Euro) mehr als dreimal so hoch wie in der „Beherbergung und Gastronomie“ (13,58 Euro), auf Ebene der ÖNACE-Abteilungen lagen sie in der „Kokerei und Mineralölverarbeitung“ (75,36 Euro) fast das 6fache über jenen in der „Beherbergung“ (13,45 Euro). Neben den großen Branchenunterschieden fällt der eindeutige Zusammenhang zwischen Arbeitskostenniveau und Beschäftigtengröße auf: Je mehr Personen in einer Erhebungseinheit beschäftigt waren, umso höher waren auch die Arbeitskosten - bei 10 bis 49 unselbständig Beschäftigten kostete die Arbeitsstunde durchschnittlich 22,66 Euro, bei
Die Arbeitskosten (ohne Auszubildende) setzten sich 2008 aus 74% direkten und 26% indirekten Kosten zusammen. Während sich die Relation direkte zu indirekte Arbeitskosten zwischen der Produktion und dem Dienstleistungsbereich insgesamt nur geringfügig unterschied, gab es in den ÖNACE-Abschnitten und -Abteilungen deutliche Abweichungen vom Durchschnitt. Einen überdurchschnittlich hohen Anteil direkter Arbeitskosten hatten die Bereiche „Filmherstellung/-verleih; Tonstudios“ sowie „Forschung und Entwicklung“ (jeweils 77,9%), während die indirekten Arbeitskosten anteilsmäßig in der „Luftfahrt“ (35,0%) und bei den „Rundfunkveranstaltern“ (33,7%) über dem Durchschnitt lagen. Dementsprechend entfiel bei letzteren sowie in den „Sonstigen Finanz-/Versicherungsleistungen“ ein hoher Anteil auf die Lohnnebenkosten (56,0% bzw. 54,3%); hier war auch der sog. Lohnnebenkostensatz (Lohnnebenkosten in Prozent des Leistungslohns) überdurchschnittlich hoch (127,1% bzw. 119,0%). Überdurchschnittlich hohe Lohnnebenkostenanteile sind in der Regel in Branchen mit hohen Gesamtarbeitskosten zu finden. Je mehr Personen in der Erhebungseinheit beschäftigt waren, umso höher war der Anteil der indirekten Arbeitskosten bzw. der Lohnnebenkosten (bei 10 bis 49 Beschäftigten 25,1% bzw. 45,7%; bei
Die Aufgliederung der Struktur der Arbeitskosten insgesamt (inklusive Lehrlinge und sonstige Auszubildende) des Jahres 2008 zeigt, dass sich diese im Durchschnitt aus 74,1% Bruttolöhnen und -gehältern, 23,3% Sozialbeiträgen der Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, 2,1% Steuern, 0,6% Kosten der beruflichen Aus- und Weiterbildung sowie 0,3% sonstigen Aufwendungen zusammensetzten. Zuschüsse, welche die Arbeitskostenbelastung reduzierten, machten 0,4% aus. Von den Bruttolöhnen und -gehältern entfielen 69,8% auf die laufenden Zahlungen (Leistungslohn), 17,4% auf die nicht mit jedem Arbeitsentgelt anfallenden Zahlungen (vor allem 13. und 14. Monatsbezug, Prämien) und 10,6% auf die Vergütung für die nicht gearbeiteten Tage. Bei den Sozialaufwendungen der Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen machten die gesetzlichen Sozialbeiträge mit 78,2% den Großteil aus, gefolgt von der Lohn- und Gehaltsfortzahlung im Krankheitsfall (10,0%), den gesetzlichen und kollektivvertraglichen Abfertigungen („Abfertigung alt“) und Abgangsentschädigungen (6,2%) sowie den tariflichen, vertraglichen und freiwilligen Aufwendungen für die Sozialversicherung (3,8%). Nach ÖNACE-Abschnitten betrachtet, waren die Bruttolöhne und -gehälter im Bereich „Erziehung und Unterricht“ (77,0%) sowie im „Gesundheits- und Sozialwesen“ (75,9%), die Sozialbeiträge (insgesamt) in der „Energieversorgung“ (25,6%) sowie in der „Wasserversorgung und Abfallentsorgung“ (25,4%) anteilsmäßig am höchsten. Geringer als die großen Kostenkomponenten streuten die Steuern und Abgaben: Sie reichten von 2,5% bei den „Finanz- und Versicherungsdienstleistungen“ bis 0,4% im „Gesundheits- und Sozialwesen“. Für die berufliche Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wendeten die „Finanz- und Versicherungsdienstleistungen“ anteilsmäßig am meisten (1,1%) auf, während Bauunternehmen am wenigsten (0,2%) dafür ausgaben.
Aufgrund der Umstellung der wirtschaftsstatistischen Klassifikation sind die Ergebnisse der Arbeitskostenerhebung 2008, basierend auf der ÖNACE 2008, mit jenen der Arbeitskostenerhebung 2004, basierend auf der ÖNACE 2003, nur bedingt vergleichbar. Die Zeitreihen zu den Arbeitskostendaten gemäß ÖNACE 2003 sind unter „Arbeitskostenstatistik (jährlich)“ zu finden.