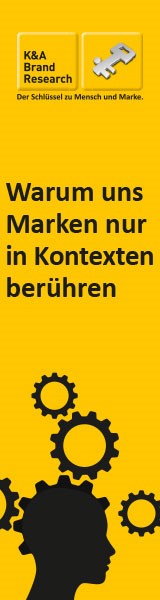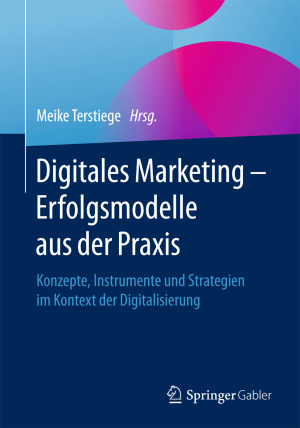Direkte Demokratie in Österreich
Das Interesse der Bevölkerung an der Politik geht zunehmend zurück. Diese unerfreuliche Entwicklung ist bei den unter 30-Jährigen besonders ausgeprägt. Auch die Zufriedenheit mit dem gelebten demokratischen System und insbesondere mit deren Repräsentanten fällt sehr mäßig aus.
| Anbieter: | Institut für empirische Sozialforschung (IFES) |
|---|---|
| Veröffentlicht: | Okt 2012 |
| Preis: | kostenlos |
| Studientyp: | Marktforschung • Sozialwissenschaftliche Studie |
|---|---|
| Branchen: | Wirtschaft, Politik & Gesellschaft |
| Tags: | Bürgerbeteiligung • Nationalraht • Parlament • Parteien • Volksbefragung • Volksbegehren • Wahl |
Das Interesse der Bevölkerung an der Politik geht zunehmend zurück. Diese unerfreuliche Entwicklung ist bei den unter 30-Jährigen besonders ausgeprägt. Auch die Zufriedenheit mit dem gelebten demokratischen System und insbesondere mit deren Repräsentanten fällt sehr mäßig aus. Vor diesem Hintergrund besteht ein breiter Konsens darüber, dass ein Ausbau der direkten Demokratie in Österreich wünschenwert wäre. Von einer breiten Mehrheit wir das Schweizer Modell auch als Vorbild für Österreich gesehen. Die Bevölkerung ist sich zwar darüber im Klaren, dass mehr Mitentscheidungsmöglichkeiten auch Gefahren mit sich bringen können (Populismus, Mehrheitsentscheidungen gegen Minderheiten usw.), dass aber die Vorteile die Nachteile klar überwiegen. Man erwartet sich bei mehr direkter Demokratie vor allem ein wieder wachsendes Interesse der Bevölkerung für Politik, eine höhere Zufriedenheit mit dem demokratischen System und einen stärkeren gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Das IFES führte im Auftrag von und in enger Zusammenarbeit mit Univ.Prof. Dr. Max Haller von der Karl Franzens Universität Graz von August bis September 2012 eine bundesweit repräsentative Befragung zum Thema "Direkte Demokratie" durch.
Starke psychische Beeinträchtigungen haben 39 Prozent der Arbeiter/-innen – gegenüber 28 Prozent der Beschäftigten im öffentlichen Dienst und 27 Prozent der Angestellten. Vor allem Bauarbeiter/-innen zählen zu den Hauptbetroffenen: 41 Prozent sind stark oder sehr stark psy-chisch belastet, gefolgt von Fabrikarbeitern/-innen (39 Prozent), Kassierern/-innen (38 Pro-zent), Installateuren/-innen (36 Prozent) und Reinigungskräften (34 Prozent). Abteilungslei-ter/-innen findet man erst dahinter mit 33 Prozent Belasteten.
Der steigende Zeitdruck spielt eine große Rolle: 40 Prozent der Beschäftigten, die unter Zeit-druck stehen, weisen mehrfache psychische Belastungen auf. Arbeiter/-innen nehmen ihre Jobs zunehmend als monoton und sinnentleert wahr. Die wirtschaftliche Entwicklung emp-finden immer mehr Beschäftigte als undurchschaubar, ihre berufliche Zukunft als unsicher. Erschöpfungssymptome und Depressionen (oft als „Burn-Out“ bezeichnet) nehmen stetig zu. Seit 1994 hat sich die Zahl der Krankenstandstage wegen psychischer Erkrankungen fast ver-dreifacht. Die Folgen sind dramatisch: 75 Prozent haben Muskelverspannungen und/oder Rü-ckenschmerzen, 67 Prozent fühlen sich erschöpft. 62 Prozent leiden unter Kopfschmerzen, 58 Prozent haben Schlafstörungen und 53 Prozent werden von Nervosität geplagt.
© 2012 Institut für empirische Sozialforschung (IFES)