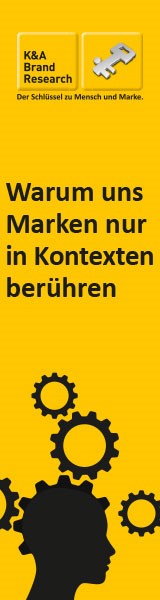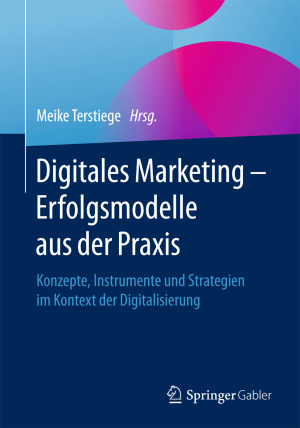Gesundheitlichen Beeinträchtigungen
Insgesamt gaben 2,4 Mio. Personen im Erwerbsalter (15 bis 64 Jahre) eine oder mehrere dauerhafte Gesundheitsbeschwerde/n an, das sind 41,6% aller Personen im Erwerbsalter. Zusätzlich zu den Gesundheitsbeschwerden wurden auch die sensorischen und motorischen Einschränkungen bei alltäglichen Tätigkeiten abgefragt. Insgesamt gaben 23,5% aller Personen im Erwerbsalter mindestens eine dauerhafte Einschränkung bei alltäglichen Tätigkeiten an
| Anbieter: | Statistik Austria |
|---|---|
| Veröffentlicht: | Feb 2013 |
| Autor: | Statistik Austria |
| Preis: | kostenlos |
| Studientyp: | Statistik |
|---|---|
| Branchen: | Branchenübergreifend • Gesundheit • Wirtschaft, Politik & Gesellschaft |
| Tags: | Beeintrachtigungen • Erwerbsstätigkeit • Gesundheitswesen • Geundheit • Krankheit • Medizin |
Erwerbstätigkeit von Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen
Unten stehende Ergebnisse stammen aus dem Mikrozensus- Ad-hoc-Modul zur "Erwerbstätigkeit von Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen" 2011 und beziehen sich auf Personen im Alter von 15 bis 64 Jahren.
Gesundheitszustand von Personen im Erwerbsalter
Insgesamt gaben 2,4 Mio. Personen im Erwerbsalter (15 bis 64 Jahre) eine oder mehrere dauerhafte Gesundheitsbeschwerde/n an, das sind 41,6% aller Personen im Erwerbsalter. Zusätzlich zu den Gesundheitsbeschwerden wurden auch die sensorischen und motorischen Einschränkungen bei alltäglichen Tätigkeiten abgefragt. Insgesamt gaben 23,5% aller Personen im Erwerbsalter mindestens eine dauerhafte Einschränkung bei alltäglichen Tätigkeiten an.
Gesundheitsbedingte Einschränkungen im Arbeitsleben
19,7% aller zum Befragungszeitpunkt erwerbstätigen Personen (das sind rund
Die am häufigsten genannte Einschränkung bezog sich auf die Art der Arbeit, 7,8% aller erwerbstätigen Personen nannten diese Einschränkung. Gemeint sind hier z.B. Einschränkungen beim Tragen schwerer Lasten, beim Arbeiten im Freien oder bei langem Sitzen (Nicht erwerbstätige Personen: 24,3%). 5,9% der Erwerbstätigen hatten gesundheitsbedingt Einschränkungen in der Stundenanzahl, die gearbeitet werden kann (Nicht erwerbstätige Personen: 23,5%). Lediglich 1,0% der Erwerbstätigen waren aufgrund bestehender Gesundheitsprobleme beim Weg von und zur Arbeit eingeschränkt (Nicht erwerbstätige Personen: 9,2%).
Arbeitsbezogene Ressourcen von Personen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen
1,6% der erwerbstätigen Personen hatten gesundheitsbedingt eine spezielle Ausstattung und/oder eine bauliche Anpassung am Arbeitsplatz. Bei Personen, die zum Zeitpunkt der Befragung nicht gearbeitet haben, gaben 4,1% an, dass sie eine spezielle Ausstattung und/oder eine bauliche Anpassung am Arbeitsplatz benötigen würden. 1,6% der erwerbstätigen Personen hatten gesundheitsbedingt spezielle Arbeitsvereinbarungen, d.h. dass die Arbeitssituation auf ihre gesundheitlichen Bedürfnisse angepasst wurde. Bei nicht im Erwerbsleben stehenden Personen meinten 13,6% sie bräuchten eine spezielle Arbeitsvereinbarung für eine mögliche berufliche Tätigkeit. 1,1% der aktuell erwerbstätigen Personen gaben an, persönliche Unterstützung am Arbeitsplatz zu haben, die aktuell nicht berufsausübenden Personen bräuchten zu 6,2% persönliche Unterstützung.
Nicht gesundheitsbedingte Einschränkungen im Arbeitsleben
Unabhängig davon, ob jemand eine gesundheitliche Beeinträchtigung hatte oder nicht, wurde jede/r Befragte gebeten, den Hauptgrund für eine mögliche Einschränkung der Erwerbsfähigkeit zu nennen. Ein Vergleich der Personen mit unterschiedlichem Erwerbsstatus zeigte, dass erwerbstätige Personen seltener nicht gesundheitsbedingte Einschränkungen in ihrer Erwerbsfähigkeit haben (14,4%) als arbeitslose Personen (32,1%) und Nicht-Erwerbspersonen (25,3%). Bei den Erwerbstätigen waren familiäre Pflichten die häufigste nicht gesundheitsbedingte Einschränkung (4,6%), hingegen sahen sich Arbeitslose (11,1%) und Nicht-Erwerbspersonen (7,3%) am häufigsten durch mangelnde Qualifikation eingeschränkt.
Die Datensätze zum Modul 2011 „Erwerbstätigkeit von Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen“ sind via Email an ake@statistik.gv.at zu bestellen.
Probleme bei funktionalen Tätigkeiten
Untenstehende Ergebnisse stammen aus der „Österreichischen Gesundheitsbefragung 2006/07“. Funktionale Beeinträchtigungen wie Einschränkungen beim Gehen, Treppensteigen oder bei der Fingerfertigkeit sowie Einschränkungen bei den Aktivitäten des täglichen Lebens können die Lebensqualität beeinträchtigen und zu Hilfsbedürftigkeit führen. Da diese Behinderungen vor allem im Alter auftreten und nur sehr wenige Personen unter 60 Jahren davon betroffen sind, wird im Folgenden nur auf die Situation bei den älteren Menschen eingegangen.
Am häufigsten treten Probleme im Bereich der Mobilität auf. Etwa ein Viertel der 60- bis 74-jährigen Frauen und über die Hälfte der Frauen über 75 Jahre weist eine Beeinträchtigung beim Bücken und Niederknien auf. Die Häufigkeiten bei den Männern liegen etwas darunter: bei 23% bzw. 39%. Bei diesen doch beträchtlichen Prozentwerten ist allerdings zu beachten, dass hier nicht nach dem Vorhandensein bzw. der Verwendung eines Hilfsmittels gefragt wurde. Probleme beim Gehen trotz Verwendung eines Stockes oder einer anderen Gehhilfe haben 14% der über 75-jährigen Österreicher und Österreicherinnen (Männer: 12%, Frauen: 15%). Schwierigkeiten beim Treppensteigen haben (trotz Verwendung eines Stockes oder anderer Gehhilfen) 12% der älteren Menschen (Männer: 9%, Frauen: 14%).
Nahezu sechs von zehn Frauen und drei von zehn Männern im Alter von 75 und mehr Jahren haben Probleme beim Tragen einer vollen Einkaufstasche (mit ca. 5 kg Gewicht). Nur sehr wenige Personen (weniger als 3% der Bevölkerung über 75 Jahre) gaben dagegen Probleme im Zusammenhang mit der Fingerfertigkeit, der Drehbewegung des Handgelenks oder mit dem Handausstrecken bzw. Händeschütteln an.