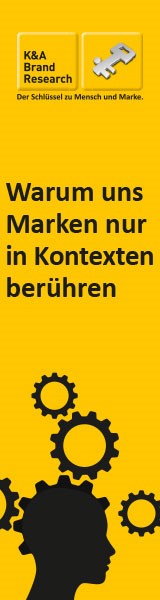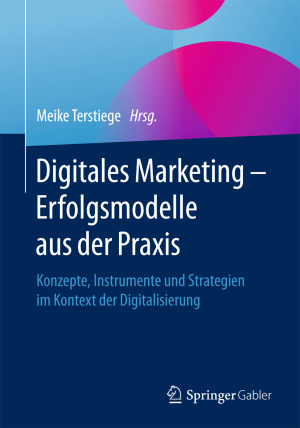Konsumklima Österreich 4. Quartal 2015
Ergebnisse des GfK Konsumklima für das vierte Quartal: Die Österreicher blicken weiter pessimistisch in die Zukunft. Die pessimistischen Konjunktur, Preis- und Einkommenserwartung wirktsich negativ auf die Anschaffungs- und Sparneigung aus.
| Anbieter: | GfK Austria GmbH |
|---|---|
| Veröffentlicht: | Feb 2016 |
| Preis: | kostenlos |
| Studientyp: | Marktforschung • Pressemeldung |
|---|---|
| Branchen: | Branchenübergreifend • Wirtschaft, Politik & Gesellschaft |
| Tags: | Anschaffungsabsicht • Kaufkraft • Konjunktur • Konsum • Optimismus • Pessimismus • Wirtschaftsklima |
Die Österreicherinnen und Österreicher bleiben skeptisch in Hinblick auf die konjunkturellen Aussichten im Inland. Eine Verbesserung der Wirtschaftsdaten halten die meisten derzeit für nicht wahrscheinlich, anders verhält sich hingegen die Stimmung in vielen anderen Ländern Europas. Die Konjunkturerwartung in Österreich stieg im Dezember gegenüber September nur um 2,8 Punkte auf aktuell -17,0 Zähler. „Die Österreicherinnen und Österreicher bleiben verhalten und trauen der eigenen Wirtschaftsleistung nicht. Vom Optimismus der Nachbarländer Deutschland, Tschechien und Slowakei oder vieler Staaten Südeuropas lassen sie sich nicht anstecken“, so Paul Unterhuber von GfK Austria.
Geringe Energiepreise beflügeln die Wirtschaft
In den meisten europäischen Ländern schwankte die Stimmung der Verbraucher im vierten Quartal 2015. Der anhaltende Flüchtlingsstrom aus den Krisengebieten im Nahen Osten und in Nordafrika war zunächst das beherrschende Thema. Zum Jahresende hin gewannen die inzwischen europaweit positiven Rahmendaten an Bedeutung. In fast allen betrachteten Ländern wuchs die Wirtschaftsleistung deutlich. Die niedrigen Rohöl- und Energiepreise sowie die kaum vorhandene Inflation sorgen dafür, dass den Verbrauchern mehr Geld im Portemonnaie bleibt, das sie für andere Dinge ausgeben können. Ebenfalls in fast allen Ländern sank die Arbeitslosigkeit im vergangenen Jahr deutlich, Ausnahme bleibt u.a. Österreich.
Die positiven Entwicklungen zeigten sich in den betreffenden Ländern in steigenden Konjunktur- und Einkommenserwartungen, in den (ehemaligen) Krisenstaaten (Griechenland, Spanien, Portugal, u.a.) reichten diese positiven Einflüsse jedoch noch nicht aus, um auch die Kauflaune der Menschen zu verbessern. Dort reicht das den Haushalten zur Verfügung stehende Geld nach wie vor kaum, um den täglichen Bedarf zu decken.
Österreich: Einkommenserwartung sinkt
Im September lag die Einkommenserwartung mit 31,1 Punkten auf dem höchsten Wert seit Oktober 1999 (32,7 Punkte). Dieser Aufwärtstrend setzte sich im vierten Quartal aber nicht fort. Der Indikator sank vielmehr um 9,4 Punkte auf 21,7 Zähler. Gleichzeitig stieg die Arbeitslosenquote laut Europäischer Kommission leicht um 0,1 Prozentpunkte an. Im November betrug sie daher wieder 5,8 Prozent.
Im Sog der pessimistischen Einkommenserwartung scheinen auch immer weniger Österreicher Lust zu haben, hochwertige Produkte und Dienstleistungen zu konsumieren. Die Anschaffungsneigung fiel seit September um 10,8 Punkte und lag zum Ende des vierten Quartals mit 0,3 Zählern nur ganz knapp über dem langjährigen Durchschnittswert von 0 Punkten. Im Vergleich mit dem Vorjahreszeitpunkt bedeutet das einen Rückgang um 15,5 Punkte. Seit dem Jahreshöchststand des Indikators im März beträgt das Minus sogar 24,2 Punkte.
„Einkommenserwartung und Anschaffungsneigung waren im vierten Quartal zwar trotz Verlusten noch im positiven Bereich, die Österreicher nutzten also insbesondere das Weihnachtsgeschäft. Offen ist, wie bei der pessimistischen Grundtendenz in Hinblick auf die Konjunktur die weitere Entwicklung ab 2016 aussehen wird“, so Paul Unterhuber abschließend.
Zur Studie
Die Ergebnisse zum GfK Konsumklima Europa stammen aus einer Konsumentenbefragung, die im Auftrag der EU-Kommission in allen Ländern der Europäischen Union durchgeführt wird. In den 28 Ländern werden monatlich etwa 40.000 Personen befragt. Diese sind repräsentativ für die erwachsene Bevölkerung in der EU.
Grundlage der GfK-Indikatoren zum Konsumklima Europa sind monatlich vorgenommene Befragungen zur Stimmung der Konsumenten. Dabei geht es zum einen um die gesamtwirtschaftliche Situation der einzelnen Länder und zum anderen um die Lage der Haushalte selbst.
Die Fragen zum Konsumklima Europa werden monatlich überwiegend im so genannten Omnibus durchgeführt. Dabei handelt es sich um eine Mehrthemenbefragung, die entweder per Telefon oder face-to-face, das heißt im Rahmen einer persönlichen Befragung, durchgeführt wird.
Aus dem monatlichen Frageprogramm von insgesamt 12 Fragen werden für das GfK Konsumklima Europa jeweils 5 Fragen ausgewählt, da sie für das Konsumklima eine entscheidende Rolle spielen.
Berechnung der ausgewählten fünf Indikatoren Konjunktur-, Preis- und Einkommenserwartung sowie Anschaffungs- und Sparneigung:
Grundlage der Ermittlung der Indikatoren sind so genannte Salden. Hier wird vom Anteil der Konsumenten, die positiv geantwortet haben (zum Beispiel: finanzielle Lage des Haushalts wird sich (viel) besser entwickeln), der Anteil derjenigen abgezogen, die negativ geantwortet haben (zum Beispiel: die finanzielle Lage des Haushalts wird sich (viel) schlechter entwickeln).
In einem weiteren Schritt wird dieser Saldo mit gängigen statistischen Verfahren standardisiert und transformiert, so dass der langfristige Durchschnitt des Indikators bei 0 Punkten liegt und einen theoretischen Wertebereich von +100 bis -100 Punkten aufweist. Empirisch waren allerdings bislang seit dem Jahr 1980 meist Werte zwischen +60 und -60 Punkten realistisch.
Zeigt ein Indikator einen positiven Wert, so ist die Bewertung dieser Größe durch den Konsumenten im langfristigen Vergleich überdurchschnittlich. Entsprechend umgekehrt ist es für negative Werte. Durch die Standardisierung können die Indikatoren unterschiedlicher Länder besser verglichen werden, da mentalitätsbedingte Niveauunterschiede im Antwortverhalten ausgeglichen werden, am grundsätzlichen Verlauf des Indikators dagegen nichts verändert wird.