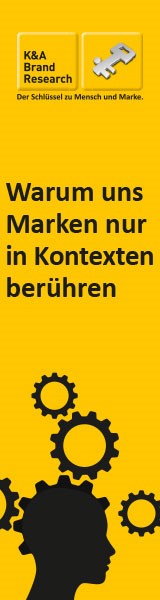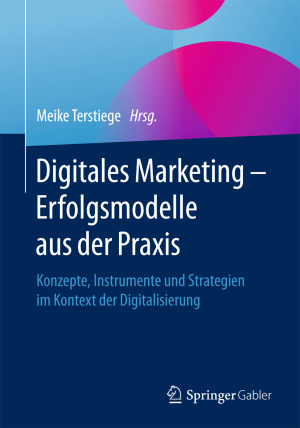Kosten unzureichender sozialer Integration von EinwanderInnen
Würde es sich für die Gemeinden, speziell für die Städte, finanziell rentieren, stärker in die „Integration“ von EinwanderInnen zu investieren? Welcher Art müssten solche Investitionen sein, um sich zu rentieren? Gibt es dabei Unterschiede zwischen den Gemeinden?
| Anbieter: | Österreichischer Städtebund |
|---|---|
| Veröffentlicht: | Dez 2013 |
| Autor: | August Gächter |
| Preis: | kostenlos |
| Studientyp: | Marktdaten • Sozialwissenschaftliche Studie • Wirtschaftsstatistik |
|---|---|
| Branchen: | Arbeitswelt • Wirtschaft, Politik & Gesellschaft |
| Tags: | Arbeitsmarkt • Beschäftigung • Finanzhaushalt • Gemeindefinanzen • Integration • Migration • Migrationshintergrund |
Das Einkommen der Gemeinden ist stark vom Einkommen der Bevölkerung abhängig. Was ihnen über den Finanzausgleich zufließt, ist zwar nach der Einwohnerzahl aufgeschlüsselt, aber die Größe des Kuchens bemisst sich nach den Einnahmen des Bundes aus einer Reihe von Steuern, vorrangig der Lohnsteuer, der Einkommensteuer und den Verbrauchssteuern. Je mehr die Bevölkerung verdient und je mehr sie davon im Inland ausgibt, desto größer ist das Budget für die Gemeinden. Zweitens gibt es die Kommunalsteuer. Die daraus erwachsenden Einnahmen ergeben sich aus der Zahl der besetzten Arbeitsplätze in der Gemeinde und aus der Höhe der dort bezahlten Löhne und Gehälter. Beschäfti - gung in Gebietskörperschaften ist von der Kommunalsteuer ausgenommen.
Auch die Ausgaben der Gemeinden sind mit den Einkommen aus Beschäftigung verbunden. In einer Stadt mit einem größeren Anteil an Beschäftigungslosen und gering Entlohnten sind die Sozialkosten in der Regel höher als anderswo. Es müssen mehr Anträge auf Zuschüsse und Beihilfen bearbeitet werden, es muss mehr ausbezahlt werden und auch der soziale Wohnbau erfordert größere Ausgaben.
Damit sich Investitionen in „Integration“ budgetär auszahlen, müssen sie sich folglich am Arbeits - markt und in den Betrieben auswirken. Es geht um mehr Beschäftigung und um Beschäftigung in besser bezahlten Stellungen. Für die Städte und Gemeinden ist das ein schwieriges Thema, denn als Akteure im Beschäftigungswesen spielen sie bisher keine prominente Rolle. Da ihr Einkommen aber in hohem Maß durch die Resultate des Beschäftigungswesens bestimmt ist, wird es für sie zunehmend bedeutungsvoll, an den Entscheidungsprozessen beteiligt zu sein. Die Sozialpartner als Hauptakteure im Beschäftigungswesen haben in den letzten zehn Jahren vor allem zwei Schwerpunkte gesetzt: Be - schäftigungsfähigkeit und Sucheffizienz der Arbeit Suchenden. Kaum im Blickfeld waren dagegen die Betriebe. Dass die Entscheidung darüber, wer Beschäftigung findet und wer nicht, und wer in einer Hilfstätigkeit beschäftigt wird und wer in einer Tätigkeit mit Aufstiegsperspektive, unsachlich gefällt werden könnte, hat sie nur wenig berührt. Für die Gemeinden ist es nicht ausreichend, dass jemand in Beschäftigung ist. Für sie zählt, dass es eine möglichst gut bezahlte Tätigkeit ist. Eine gelernte Krankenpflegerin als Raumpflegerin arbeiten zu sehen, ist für sie höchst frustrierend. Das Problem der inadäquaten Beschäftigung von EinwanderInnen ist in Österreich von vergleichsweise großer Bedeu - tung. Innerhalb der EU hat es nur in Griechenland, Italien und Spanien gleiches oder noch größeres Ausmaß.
© 2013 Österreichischer Städtebund