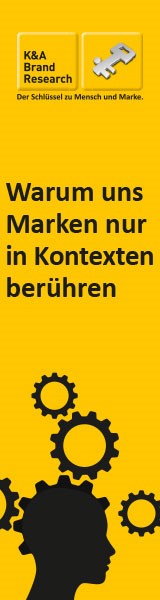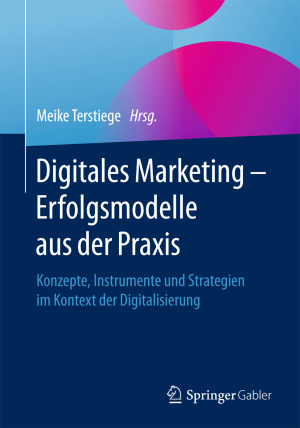Wie geht's Österreich ?
Das Indikatorenset „Wie geht’s Österreich?“ von STATISTIK AUSTRIA liefert konzise interaktive Informationen und Schlüsselindikatoren zu verschiedenen Dimensionen von Wohlstand und Fortschritt. Indikatoren zu materiellem Wohlstand, Lebensqualität und Umweltentwicklung ergänzen das Bruttoinlandsprodukt (BIP) und tragen damit zu einem breiteren Verständnis der Wohlstandsentwicklung unserer Gesellschaft bei. STATISTIK AUSTRIA setzt dabei die Empfehlungen der sogenannten „Sponsorship Group on Measuring Progress, Well-being and Sustainable Development“ entsprechend der nationalen statistischen Datenlage weitgehend um. Weitere definierte Zielindikatoren auf EU-Ebene (z. B. Europa 2020-Indikatoren) und OECD-Ebene sowie nationale Projekte flossen ebenfalls in die Indikatorenauswahl ein.
Inhalt
Abkürzungsverzeichnis 10
Einleitung 13
Executive Summary 17
1
Was ist „Wie geht’s Österreich“ 25
1.1 Hintergrundinformation 26
1.2 Bewertung 27
1.3 Kommunikation / Dissemination 29
1.4 Europäische Rahmenbedingungen 31
2
Materieller Wohlstand 35
2.1 Dimensionen des materiellen Wohlstands 36
2.2 Produktion 37
2.2.1 Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 37
2.2.2 Arbeitsproduktivität 38
2.3 Einkommen der privaten Haushalte 40
2.3.1 Haushaltseinkommen 40
2.3.2 Verfügbares Einkommen – Aufkommensseite 41
2.3.3 Verfügbares Einkommen – Verwendungsseite
42
2.4 Konsum der privaten Haushalte 43
2.4.1 Haushaltskonsum 43
2.4.2 Zusammensetzung des Haushaltskonsums
44
2.5 Verteilungsaspekte 45
2.5.1 Hohe und niedrige Bruttojahreseinkommen
45
2.5.2 Subindikator Gender Pay Gap 46
2.5.3 Subindikator Einkommensquintilsverhältnis
(S80/S20) 47
2.6 Unbezahlte Produktion 50
2.6.1 Zeitaufwand für unbezahlte Arbeit 50
3
Lebensqualität 53
3.1 Dimensionen der Lebensqualität 54
3.2 Materielle Lebensbedingungen 56
3.2.1 Armuts- oder Ausgrenzungsgefährdung 56
3.2.2 Subindikator Verfestigte Deprivation 58
3.3 Produktive Aktivitäten und Arbeit 59
3.3.1 Erwerbstätigenquote 59
3.3.2 Subindikator Arbeitslosigkeit 61
3.3.3 Subindikator Arbeitszufriedenheit 63
3.4 Gesundheit 64
3.4.1 Subjektive Gesundheit 64
3.4.2 Subindikator Soziale Lebenserwartungsdifferenzen
66
3.5 Bildung 68
3.5.1 Tertiärquote 68
3.5.2 Subindikator Bildungsniveau 70
3.5.3 Subindikator Frühe Schul- und Ausbildungsabgänger 71
3.5.4 Subindikator Intergenerationeller Bildungsvergleich 71
3.6 Soziale Teilhabe 73
3.6.1 Tragfähigkeit sozialer Beziehungen 73
3.7 Freizeit 75
3.7.1 Freizeitaktivitäten 75
3.8 Physische Unsicherheit 77
3.8.1 Physisches Unsicherheitsempfinden 77
3.8.2 Subindikator Mordrate 78
3.9 Qualität der gesellschaftlichen Organisation 80
3.10 Natürliche Wohnumgebung 82
3.10.1 Subjektive Umweltbelastung in der Wohnumgebung 82
3.11 Gesamte Lebenszufriedenheit 85
3.11.1 Subjektive Lebenszufriedenheit 85
4
Umweltorientierte Nachhaltigkeit 89
4.1 Dimensionen der umweltorientierten Nachhaltigkeit 90
4.2 Ressourcen 92
4.2.1 Inländischer Materialverbrauch 93
4.2.2 Bio- und Naturschutzflächen (laut ÖPUL) 95
4.2.3 Bau- und Verkehrsflächen 96
4.3 Klimawandel, Emissionen 98
4.3.1 Treibhausgasemissionen 98
4.3.2 Phosphoremissionen im Abwasser 101
4.3.3 Abfälle aus Haushalten 102
4.4 Energie 105
4.4.1 Erneuerbare Energieträger 105
4.4.2 Energetischer Endverbrauch 107
4.4.3 Energieintensität 108
4.5 Verkehr, Mobilität 110
4.5.1 Energieverbrauch des Verkehrs 110
4.5.2 Fahrleistung des Lkw-Verkehrs 112
4.5.3 CO2-Emissionen von Pkw-Neuzulassungen113
4.6 Monetäre Umweltaspekte 115
4.6.1 Umweltschutzausgaben 115
4.6.2 Ökosteuern 116
4.6.3 Umweltwirtschaft 119
5
Zusammenhänge 123
5.1 Nachhaltigkeit als gemeinsame Klammer 124
5.2 Sozio-ökonomische Zusammenhänge 126
5.3 Interdependenzen der Lebensqualität 128
5.4 Ökologische Perspektive 132
5.4.1 Bruttoinlandsprodukt und Umweltfaktoren 133
5.4.2 Haushaltseinkommen und Umweltfaktoren 135
5.4.3 Haushaltskonsum und Umweltfaktoren 136
6
Ausblick 139
Literaturverzeichnis 145
Wie geht’s Österreich? – Sonderkapitel Lebensqualität:
Die Determinanten des subjektiven Wohlbefindens 155